Die Sozialwissenschaften gliedern sich bei näherer Betrachtung in verschiedene Teilbereiche, die sich allesamt durch Eigenheiten und Besonderheiten auszeichnen. Hierzu gehört unter anderem auch die Sozialpädagogik, die sich in erster Linie der Förderung der Eigenverantwortung widmet. So sollen vor allem junge Menschen in die Lage versetzt werden, ein eigenständiges Leben als Mitglied der Gesellschaft zu führen.
Was ist Sozialpädagogik?
Der Begriff Sozialpädagogik kam erstmals im Jahr 1844 auf, denn damals widmete Karl Mager dieser Disziplin einen Artikel, der in der „Pädagogischen Revue“ veröffentlicht wurde. Mittlerweile hat sich diese weiterentwickelt und kann als vielseitiger Wissenschaftszweig definiert werden, der die sozialstaatliche Intervention, Bildung sowie Erziehung kombiniert.
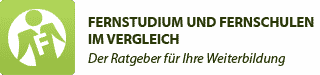

 In unserem letzten Beitrag haben wir Kindeswohlgefährdung, Missbrauchsfälle und gewaltsame Übergriffe in Familien sowie die Verantwortung des Staates für den Kinderschutz und die schwierige Rolle der Jugendämter betrachtet.
In unserem letzten Beitrag haben wir Kindeswohlgefährdung, Missbrauchsfälle und gewaltsame Übergriffe in Familien sowie die Verantwortung des Staates für den Kinderschutz und die schwierige Rolle der Jugendämter betrachtet. Meldungen von Kindeswohlgefährdung während Ferienfreizeiten, Missbrauchsfällen in kirchlichen Einrichtungen, gewaltsamen Übergriffen in Familien oder Kindstötung erschüttern unsere Gesellschaft.
Meldungen von Kindeswohlgefährdung während Ferienfreizeiten, Missbrauchsfällen in kirchlichen Einrichtungen, gewaltsamen Übergriffen in Familien oder Kindstötung erschüttern unsere Gesellschaft.